In unserer Zeitung steht heute ein Zitat von Margot Käßmann: „Angehörige sind in Sorge, dass Eltern oder Großeltern in Heimen frühzeitig sterben. Nicht an Covid-19, sondern an der Isolation, weil die Einsamkeit ihnen den Lebensmut nimmt.“
Ich überprüfe innerlich, ob ich diese Sorge teile. Vielleicht. Meine Schwiegeroma lebt in einem Pflegeheim. Sie ist dement. Wie sehr sie wohl die Besuche vermisst, die seit langem eingestellt sind? Wir wissen es nicht. Sie kann es wohl auch nicht mehr ausdrücken.
Ich habe aber auch ältere Angehörige, die nicht im Heim wohnen. Meine Eltern. Meine Schwiegereltern. Meine betagte Tante. Sie versuchen zurecht zu kommen mit der neuen Situation und sich, so gut es geht, abzuschotten. All ihre Freizeitaktivitäten, die ihren Alltag bunt gemacht haben, sind storniert. Das ist schwer zu fassen.
Natürlich raten wir ihnen ab, selbst einzukaufen. Bringen ihnen, was sie brauchen, oder sind froh, dass sie anderweitig versorgt werden. Daher besuchen wir sie auch nicht, kommen nur zu einem Schwatz über den Zaun, um Eingekauftes abzugeben. Ja, auch Videoanrufe sind möglich, der modernen Technik sei Dank. Mit meiner Tante, die weiter weg wohnt, telefoniere ich mit dem guten alten Festnetztelefon. Whatsapp oder Skype hat sie nicht. Sie lebt alleine und hat es besonders schwer. Wir erzählen einander von unserem Alltag unter den neuen Bedingungen. Obwohl Besuche gerade keinen Sinn machen, ist sie nicht wehleidig.
So weit – so gut. Und doch -wenn ich ehrlich bin- bleibt trotz all dieser tapferen Versuche, das Beste aus der Situation zu machen, ein Unbehagen in mir. Ich merke es, wenn ich Zeit habe nachzudenken. Dann spüre ich, dass die unwägbar lange Zukunft mit Corona in mir tiefe Fragen auslöst. Es geht ja nicht mehr nur um die disziplinierte Überbrückung einiger weniger Wochen. Es geht mittlerweile um viele Monate, um ein Jahr oder mehr.
Dann frage ich mich bedrückt: Wie lange möchten wir wirklich aushalten, uns nicht treffen zu können? Wann endlich wird der Zeitpunkt kommen, dass wir als Familie wieder beieinander sind und miteinander eine gute Zeit erleben? Wann ist es wieder möglich, gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen? Und letztendlich: Wie viel Zeit bleibt uns noch für all das?
Wir schützen die alten Menschen zu Recht. Wir haben uns Distanz verordnet. Eine Ansteckung wäre mit Lebensgefahr verbunden. Und doch belastet mich die Frage, ob wir nicht dagegenrechnen müssen, dass die Qualität der verbleibenden Lebenszeit auch eine Größe sein muss. Sie bemisst sich nicht in Risiken, sondern in Freude und Begegnung.
Was ist vertretbar? Ich merke, dass Corona mir ethische Fragen aufzwingt, die mich sehr unsicher zurücklassen.

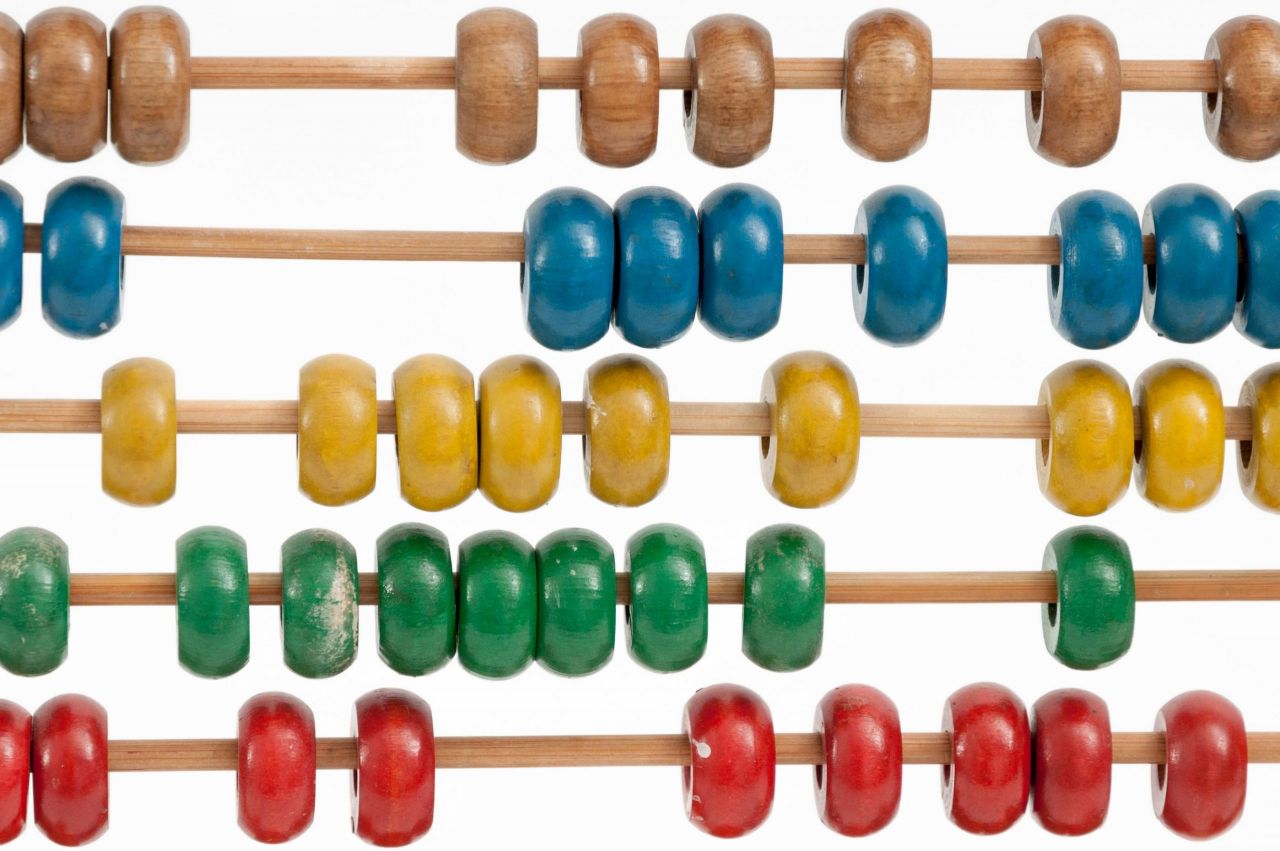




Menschen nicht zu gefährden ist selbstverständlich. Menschen deshalb wegzusperren – und das trifft nicht nur die Alten, sondern auch die Kinder und Jugendlichen – ist inhuman. Menschen selbst entscheiden zu lassen, wie viel Unfreiheit sie sich antun möchten in der Hoffnung, etwas länger zu leben, wäre in meinen Augen richtiger. Wo bleibt für diese Menschen die Lebensqualität?
Meine Tochter und ich haben uns zwei Monate nicht gesehen und uns natürlich beim Wiedersehen umarmt. Wenn ich morgen sterbe wäre es das Schlimmste für mich, wenn wir uns nicht mehr umarmt hätten. Was macht Leben aus? In Bayern bestehen die striktesten Kontaktsperren und dort gibt es die höchsten Fallzahlen. Sollte uns das nicht zu denken geben?
Wir sollten dringend überlegen, was Leben lebenswert macht und wo Erhalt um jeden Preis zum Fluch wird.
Ist nicht immer schon das Leben lebensgefährlich gewesen?
Isolation gilt als schlimme Folter.
Wer kann wirklich entscheiden, was gut ist?
Ich darf andere Menschen nicht extra in Gefahr bringen.
Doch wenn Angehörige untereinander frei und bewusst und doch achtsam den Kontakt der Isolation vorziehen??
Im Moment haben wir nicht die Freiheit selbstständig zu entscheiden.